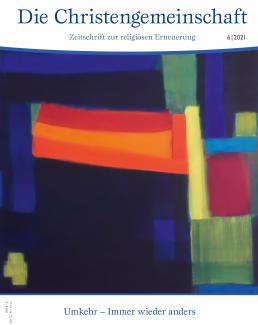Das Wesentliche der Umkehr ist die vorausgegangene Krise
Wenn es irgendwo nicht weitergeht, dann kehrt man um und probiert es an einer anderen Stelle. Das ist sehr einleuchtend, solange wir wandern, klettern, fahren. Fahren grenzt aber schon an den Bereich, an dem einfaches Umkehren nicht mehr ohne Weiteres sinnvoll ist. Nach dem Weg fragen, umkehren und den anderen Weg nehmen, kann hier schon ein Zeugnis für geleistete (Selbst-)Überzeugungsarbeit sein. Es gibt auch diejenigen, die nicht gerne ein und denselben Weg, den sie gekommen sind, wieder zurück spazieren. Eine gute Runde scheint perfekt. Ein einziger Weg und am Ende ist man wieder am Anfangspunkt. So hätten wir das sehr gerne und so richten wir uns auch ein.
Umkehren im Sinne von Johannes dem Täufer bedeutet, sich dem Christus auf- und anzuschließen. Einen Wechsel des Glaubens einzugehen. Umkehren, die Richtung ändern, annehmen, dass man einen anderen Weg zu gehen hat und gehen will. So steht es geschrieben. Und so hat sich seither das Christentum entfaltet und ausgebreitet und ist in immer wieder neuen Formen erschienen. Bis hin zur heutigen Form. Das meint nicht unbedingt Kirchenchristentum – unser gesamtes soziales Miteinander ist christlich geprägt. Aber was ist denn nun christlich? Ist es die Zugehörigkeit zur Gemeinde? Reicht es, wenn ich an Christus glaube und ein christliches Leben führe? Was bedeutet »ein christliches Leben führen«?
Nehmen wir einmal an, es stimmt, dass wir nur vorübergehend Erdenbürger sind und unsere wahre Heimat im Himmel ist. Nehmen wir zudem einmal an, dass wir hier auf der Erde eine bestimmte Aufgabe haben, aber den größten, längsten Teil unseres Lebens nicht auf der Erde, sondern im Himmel verbringen und über kurz oder lang dorthin zurückkehren. Dann könnte man sich fragen: Warum hier so ein Aufhebens machen, wenn es nicht ganz so läuft wie gedacht? Man könnte ja einfach jederzeit wieder umkehren und es auf eine andere Weise versuchen. Warum vertrauen wir uns der Umkehr nicht an? Ich vermute, dass wir immer Angst haben und immer Sicherheit suchen. Wir wollen sicher sein, dass »es gut geht«. Wir wollen perfekt sein und unser Leben meistern und doch wissen wir: Seit Golgatha liegt diese Sicherheit in der Kraft des Glaubens. Die Sicherheit, die wir während der letzten 50 Jahre erlebt haben, ist dagegen ein Trugbild. Sie gaukelt uns eine Welt vor, die so nicht ist. Keiner von uns weiß, wann sein Ende kommt. Sein Ende hier auf der Erde, welches, in Anbetracht der geistigen Welt, kein Ende ist. Und doch zeigen wir uns überrascht, sobald sich »etwas« ändert, und sind bestürzt über die Möglichkeit, dass wir sterben könnten. Wie furchtbar wird denn der Tod noch sein, wenn er das beglückendste Ereignis des Lebens nach dem Sterben sein wird und alles überstrahlt? Wie würden wir leben und sterben, hätten wir wirklichen Glauben in Christus?
Was wissen wir von Johannes dem Täufer, dem Prediger in der Einsamkeit? Er lebt in der Wüste, ernährt sich von wildem Honig und Heuschrecken, trägt ein Gewand aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel. Warum sollen wir wissen, von was er sich ernährt und wie er sich kleidet? Alles in allem ist er eine Gestalt, auf die wir in der heutigen Zeit wohl kaum hören würden. Wir würden ihn vielleicht sogar für verrückt erklären. Aber er ruft. Ein Rufender ist er, und man könnte sich fragen, warum einer an einem verlassenen Ort ruft. Wie groß sind die Chancen, dass jemand ihn hört? Sein Ruf ertönt jedoch weithin und bis heute. Beinahe mahnend. Reicht es heute noch, seine Fehler zu bekennen und sich taufen zu lassen? Worin besteht die Taufe heute? Untergetaucht sein in Wasser, bis der Atem nicht mehr ausreicht, um alleine aufzustehen? Und wie geht das heute mit der Umkehr?
Jedes Mal, wenn ich die Verurteilung und Kreuzigung in der Karwoche höre, wünsche ich, Petrus wäre wach genug, um ihn nicht zu verleugnen. Ich möchte Pontius Pilatus zureden, dass er auf sein Herz hören soll. Ich kann nicht verstehen, wie man so sehr wollen konnte, dass er gekreuzigt werden sollte. Und im selben Moment weiß ich, dass es so kommen musste und wir immer noch die Verhandlungen führen, ihn immer noch verleugnen und kreuzigen und immer noch fähig sind, uns taufen zu lassen, ihm zu begegnen und seine Wunden in uns selbst zu erkennen. Wir sind sehr schnell dabei, Pontius Pilatus zu verurteilen. Hat er nicht um ein Urteil gerungen und eine Entscheidung getroffen? Das war seine Aufgabe. Er ist in unseren Augen gescheitert. Viele haben sich »falsch« entschieden, und wir entscheiden uns auch immer noch falsch. Doch wir haben die Aufgabe mit auf den Weg genommen, die richtigen Entscheidungen zu suchen. Diese finden wir nur, indem wir Entscheidungen fällen und unser Scheitern anerkennen. Keinen Entschluss zu ergreifen hilft nicht, der Wahrheit näher zu kommen.
Wir können uns damit trösten, dass in jedem von uns ein Pharisäer, ein Petrus, ein Kaiphas, ein Pilatus steckt und sie alle in der Geschichte zu der Erfüllung der Prophetenworte beigetragen haben. Sie haben gefehlt und sind gescheitert, aber nicht in vollem Sinne. Worum geht es? Es ging zur Zeit des Täufers darum, sich der christlichen Religion anzuschließen. Worauf kommt es denn heute an, wenn der Ruf zur Umkehr erklingt, was können wir antworten? Welcher »Sinn« soll sich ändern? Wir können versuchen, uns an den Jüngern und Aposteln zu orientieren, die um so vieles »besser« waren als wir. Die so vieles mit auf den Weg bekommen haben. In jedem von uns steckt wohl auch ein Philippus, ein Thomas oder Johannes. Auch sie haben ihren Teil dazu beigetragen, dass sich das Ereignis von Golgatha erfüllen konnte. Und auch sie sind auf eine Art gescheitert. Und nun sind wir dran, etwas zu tun. Zu scheitern vielleicht, vielleicht aber auch, Änderungen anzunehmen. Uns immer wieder neu zu orientieren, immer wieder neu zu glauben, immer wieder neu zu bekennen, dass wir Christen sind. Menschen, die täglich darum ringen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wir treffen sie und wir scheitern vielleicht und wir kehren um und versuchen es erneut, aber anders.