Auf zwei Wegen kann Gott als gegenwärtig erlebt werden: Erfahre ich ihn in der Welt, ist er mir Gegenüber, meinem kleinen Ich ein großes Du. Werde ich seiner im eigenen Inneren gewahr, ist er mir näher, wird er meinem mystischen Ich ein Welten-Ich. Gegenübersein und Innewohnen scheint mir auch ein Bauprinzip christlicher Gemeinschaft zu sein. Begegnen wir uns darin, dass in uns der gleiche Gott anwesend wird, sind wir uns auch einander näher als in der latenten Fremdheit des Gegenübers. In der Nähe Gottes brauchen wir keine Vermittler, auch nicht mehr untereinander. Das meinte der Apostel Paulus wohl, als er an Timotheus schrieb: »Denn es ist nur ein Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch gewordene Christus Jesus« (1 Tim 2,5). Im Blick auf das Gemeinschaftsleben von Christen soll mit dieser Beitrags-Serie die Frage bewegt werden, was wir einander sein können und wollen, wenn uns einzig Christus als Mittler gilt.
Religiöses Handeln
Die ersten beiden Teile dieser Beitragsserie waren der Entwicklung des religiösen Denkens und Fühlens gewidmet. Im dritten Teil geht es nun um den religiösen Willen, um religiöses Handeln. Dabei stellt sich sogleich die Frage: Wie kann sich unser eigener, menschlich-unvollkommener Wille mit der Allmacht Gottes, mit seiner vollkommenen göttlichen Kraft vereinbaren lassen?
Oft hat man den Eindruck, dass es hier um ein Entweder-oder geht. Gelingt es jedoch, unterschiedliche Willensrichtungen einander anzunähern, kommt ein Wandel der Willensrichtung in den Blick, indem wir in etwas ein-willigen. Im Einwilligen füge ich meinen Willen in einen anderen Willen ein – oder, und das wäre schon eine religiöse Wendung: ich nehme einen anderen Willen in meinen Willen auf. Zwei Willen werden zu einem vereint. Genau darum bitten wir ja im Vaterunser, wenn wir unser inneres Ergebenheitsgefühl aktivieren und sprechen: »Dein Wille geschehe …« Wir bitten die Wirksamkeit seines Willens vom Himmel zur Erde herab und halten uns mit offenem Herzen bereit, seinen Willen in unserem Willen zu empfangen. Begegnet uns der umfassende göttliche Wille auf diese Weise, so wird unser eigener, noch im Wachstum befindlicher Wille nicht etwa ausgelöscht, sondern erfüllt. In dieser Weise lese ich die folgenden Verse aus dem Hebräerbrief des Neuen Testaments:
Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, mache euch bereit in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen (Hebr 13,20–21).
Den eigenen Willen öffnen
Wenn hier vom »Bereitmachen in allem Guten« die Rede ist, wird deutlich, dass es einer eignen Voraussetzung bedarf: der inneren Bereitschaft im Menschen, sich von dem zu reinigen, was dem Guten noch nicht entspricht, und sich im Zuneigen zum Guten selber schon vom Guten leiten zu lassen. Der Hebräerbrief geht sogar noch ein Stück weiter: Wir können den Willen Gottes tun, weil wir aus seinem Willen dazu befähigt werden. Anders als beim Handeln aus eigener Überzeugung und Zielsetzung bedarf es für das »Handeln aus Gott« eines Schrittes aus der Welt der irdischen Ökonomie in die Welt der göttlichen Ordnung. Das Übertreten dieser Schwelle geschieht in dem, was im religiösen Sinne »Opfer« genannt wird. Opfern bedeutet, den eigenen Willen so zu öffnen, dass nicht nur eine Einigung in Bezug auf ein bestimmtes Ziel, sondern ein Aufgehen des einen Willens in den anderen möglich wird. Nicht nur eine Einigung, sondern eine Einswerdung geschieht in einem solchen auf Wandlung angelegten Akt des Opferns. Diese Schicht wird erreicht, wenn wir beispielsweise das Vaterunser so beten, dass wir uns im Sprechen mit dem verbinden, der es seinen Jüngern und damit auch uns gegeben hat: mit Jesus Christus. Das Mitsprechen der Worte Jesu ist ein religiöses Handeln, in dem wir schon im »Unser« mit Christus verbunden sind und im Blick auf den »Vater im Himmel« auch mit dem Vatergott Wiederverbindung (lat.: religio) suchen. Aus dem gleichen Geist handeln wir im Mitvollbringen der Sakramente: Mit unserem eigenen religiösen Willen fügen wir uns in die Opfertat ein, die Christus als der Hohepriester[1] am Altar vollzieht.
Der Alltag: Eine besondere Herausforderung
Eine besondere Herausforderung ist vielleicht heute mehr als früher, wie sich die innere Haltung des Opferns auch in den Alltag hineintragen lässt. Viele Handlungen sind durch die Verbindung mit dem Nutzen technischer Geräte entfremdet – wir haben schon damit viel zu tun, den »kalten« Willen der Maschine durch den eigenen Willen auf »Herzwärme« zu bringen. Darum ist es wohl vor allem der Raum »echter« menschlicher Begegnungen, in dem wir unseren religiösen Willen betätigen können. Viel kann für den Frieden in unserer Welt dadurch geschehen, dass wir den im religiösen Üben erlebten göttlichen Frieden zwischen uns Menschen wirksam machen. Auch dafür sind wieder die Übergänge zu bemerken: Gelingt es, die gehobene Seelenstimmung von Meditation, Gebet und sakramentaler Feier innerlich so nachklingen zu lassen, dass sie nicht zurückbleiben, sondern auf den Weg in den Alltag mitgenommen werden können? Trifft dann wieder Wille auf Wille, kann ich vielleicht ernst damit machen, den eigenen Willen zurückzunehmen, ihn mit anderem Willen zu verbinden oder gar durch Begegnung zu transformieren.
Der Frieden des Vatergottes
In der oben zitierten Hebräerbrief-Stelle wird der Vatergott »Gott des Friedens« genannt. Wie lässt sich dieser Frieden vorstellen? In der aktuellen Zeitlage sprechen wir viel von einem Frieden, der nach dem hoffentlich bald möglichen Ende der Kriege wieder eintreten soll. Damit erscheint er als Gegensatz zum Krieg, manchen auch nur als dessen Abwesenheit. Können wir uns dagegen eine Form des Friedens vorstellen, die weder Ende noch Abwesenheit, sondern aktiver, schöpferischer Beginn und Vergegenwärtigung friedensstiftender Kraft ist? Der Gott des Friedens ist denen aktiv zugewandt, denen er seinen Frieden schenkt. So hat ihn schon der Psalm-Sänger beschrieben:
Der Herr schaut vom Himmel herab, er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab, er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat sie ja alle erschaffen, eines jeden Herz; er achtet auf alles, was sie tun. (…) Es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Denn er will sie vor dem Tod retten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn; er allein ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt. Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen, und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen (Psalm 33,13–15 und 18–21).
Kannst du hinsehen?
Nehmen wir die hier geschilderten Tätigkeiten Gottes noch einmal in Erinnerung, so wird deutlich, dass sich darin eine tiefe Verbundenheit ausspricht: Er sieht seine Geschöpfe und ihre Taten, schaut nach ihnen, will sie vor dem Tod retten und sie in Hungersnot am Leben erhalten. Krieg geschieht dagegen aus Unverbundenheit und Fremdheit, aus dem aktiven Wegschauen und Herabwürdigen der Anderen und ihrer Taten; Krieg bringt Tod und Hungersnot, er verhindert und zerstört Leben. Frieden und Krieg stehen unversöhnt gegeneinander und fordern uns auch im Alltag sogenannter »Friedenszeiten« zu Entscheidungen heraus: Willst du hinsehen, würdigen und dem Leben dienen? Oder schaust du weg, entwürdigst und handelst gegen das Leben?
Jenseits aller Trennungen
Der Vatergott ist nicht nur Gott des Friedens, in ihm hört jede Art Trennung auf, Wirksamkeit zu entfalten. Denn aus ihm als dem Daseinsgrund alles Gewordenen ist alles hervorgegangen. Was auch immer geworden ist, kann zu allen Zeiten seinen Ursprung, seine tiefste Wurzel in seinem göttlichen Sein wissen. Im Vater sind alle Gegensätze vereint, sogar Leben und Tod sind in ihm ungetrennt. Anders gesagt: Das Leben ist ihm so groß, dass es den Tod umfasst. Folgen wir dieser Spur, ergibt sich für das religiöse Handeln aus der Kraft göttlichen Friedens, dass wir aufgefordert sind, alles Gewordene, Mitmenschen, Mitgeschöpfe, die Naturwelt und alles, was Menschen für das Leben geschaffen haben, als mit uns verbunden anzusehen. Auf der Ebene des Seins dürfen wir uns als ungetrennt von allem erkennen und anerkennen. Der Vater und sein ewiges Sein ist der tiefste und umfassendste Quell der Gemeinsamkeit, in ihm sind alle Menschen Kinder und untereinander Geschwister. Im tätigen Sinne religiös wird dieses Erkennen und Anerkennen erst dann, wenn wir es willentlich aktivieren. Hier wirkt der Wille nicht mehr in intendierte Richtungen, sondern öffnet sich in die ewigen Weiten des reinen Seins. Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Römer davon geschrieben, wie er sich auch in Bezug auf Leben und Sterben Gott immer zugehörig fühlen will: Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn; ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn (Röm 14,8).
In jedem Menschenantlitz Schwester oder Bruder sehen
Für das Miteinander unter Christen kann diese Ansicht dazu führen, in jedem Menschenantlitz Schwester oder Bruder sehen zu wollen, aber auch Tiere, Pflanzen und Steine als Gefährten im göttlichen Sein zu erfassen. Das Mosaische Gebot der Bruder- und Nächstenliebe, das Jesus im Neuen Testament bekräftigt und bis zur Feindesliebe steigert, ruft eine Beziehung stiftende Kraft auf, die den Anderen wie auch das eigene Selbst umfassen soll:
Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr (3 Mose 19,17–18).
Es gilt, vom eigenen Herzen aus die Nächsten – also alle Schöpfungsgeschwister – und zuletzt auch uns selbst im göttlichen Frieden anzunehmen.
Foto: Christian Bartholl
[1] Siehe den einführenden Beitrag in Heft 1-2025, S. 21.
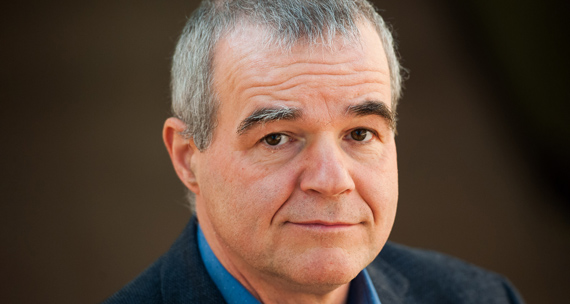
Verfasst von Ulrich Meier
geboren 1960, Priester in Hamburg



