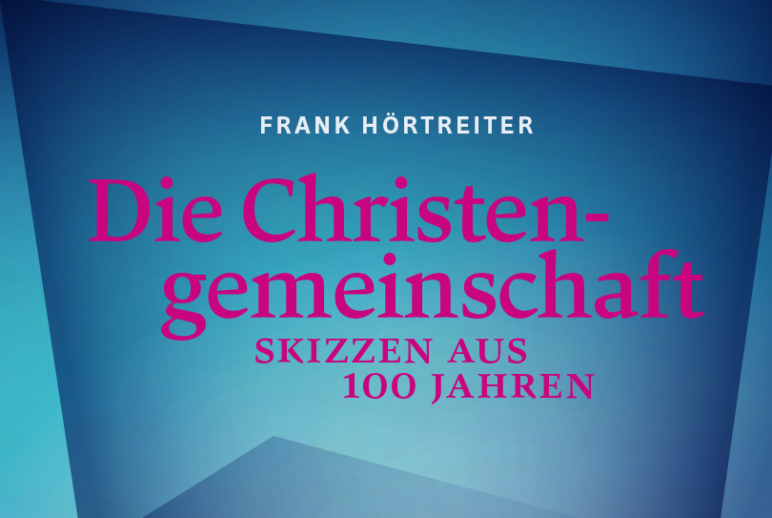Heute möchte ich Sie auf ein neu erschienenes Buch hinweisen, und zwar auf eines, welches unsere Christengemeinschaft direkt betrifft: Frank Hörtreiter, dessen Studie „Die Christengemeinschaft im Nationalsozialismus“ (2021) manche von Ihnen zur Kenntnis genommen haben werden, hatte schon lang vor Entstehung dieser Studie für eine größer angelegte Geschichte der Christengemeinschaft geforscht, Themen geordnet und Thesen vorbereitet, fand aber, dass dieses wichtige Thema (Nationalsozialismus) nicht nur ein Kapitel neben anderen sein kann.
Die Christengemeinschaft im Nationalsozialismus – ein extra Kapitel
Diese Studie fand viel Anklang und wurde zum Beispiel auch seitens der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) sehr wohlwollend aufgenommen. – Nun ist vor einigen Wochen von ihm erschienen: „Die Christengemeinschaft. Skizzen aus 100 Jahren“. Wer mit der Christengemeinschaft verbunden ist und sich für sie interessiert, wird diese 160 Seiten (mehr umfasst der Haupttext tatsächlich nicht) ganz gewiss mit Gewinn lesen – und auf manches Wichtige stoßen, das bis dahin nur wenig bekannt war. Wussten Sie zum Beispiel, dass Friedrich Rittelmeyer schon sehr früh (1927) darauf drängte, bei der Gemeindebildung nicht zu viel Gewicht auf das Halten von Vorträgen zu legen (S. 28)?
Sinnige, teils überraschende Gliederung
Hörtreiter gliedert die ersten 100 Jahre der Christengemeinschaft wie folgt:
- – Anfangsjahre der Gemeindegründung (1922 – 1933)
- – Enttäuschte Hoffnungen, Verbotsgefahr und innere Steigerung (1933 – 1945)
- – Chance des Neubeginns (1945 – 1953)
- – Vorträge, Jugendarbeit und Kirchenbauten (1954 – 1961)
- – Formbildung, Führungskrise und Offenheit für veränderte Zeitumstände (1961 – 1974)
- – Kirchenbauten, Sorge um die Umwelt, »langer Atem« (1975 – 1989)
- – Die Christengemeinschaft in der DDR
- – Nach der Wende – noch ein Neubeginn? (1989 – 2000)
- – Kulmination und Abschwung? (2000 – 2025)
Perspektive eines jahrzehntelangen Zeugen
Der Autor hat nicht nur mehr als die Hälfte dieses ersten Jahrhunderts der Christengemeinschaft miterlebt und als Priester mitgestaltet, sondern überdies eine große Anzahl von Persönlichkeiten aus der ersten Stunde persönlich gekannt, sodass wir vieles aus erster Hand erfahren. Er hat mit diesem Buch keine Chronologie vorgelegt, sondern eben diese Skizzen, also mit bewusst gesetzten Schwerpunkten. Dazu gehört besonders auch das Kapitel über Priesterinnen: Zwar darf sich die Christengemeinschaft auf ihre Fahnen schreiben, dass zu dem mit ihrer Gründung inaugurierte Priestertum auch das der Frauen gehört, das bedeutet aber nicht, dass die so konstituierte Gleichberechtigung in der Praxis von Anbeginn an tatsächlich gelungen sei, vielmehr gab es erhebliche Hemmnisse (S. 107ff) … Überhaupt ist erfrischend, wie klar – und immer konstruktiv – Mängel und Schwächen benannt werden; das öffnet an vielen Stellen den Blick für die anstehenden Aufgaben!
Einige Leseproben:
„Es war ein langer Weg von der Pionierstimmung der jungen Gemeinden, in denen der Priester als ‚natürliche Autorität‘ fast alles wie ein aufgeklärter Monarch zu entscheiden hatte, zu stärkerer Gemeinschaftlichkeit im Austausch, zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit – auch über die Gemeindegrenzen hinaus – und zu einer strukturierten und durchschaubaren Führung.“ (S. 93)
„Es gibt … keine Forderung nach sittlichem Gehorsam. [Die] Mitglieder … sollen in ihrer individuellen Ethik auf keine einheitliche Linie gebracht werden. (…) Eine Entscheidung aus eigener Einsicht und Willensanstrengung hat einen höheren persönlichen Wert als gehorsam befolgte Regeln. Sie steigert das Freiheitserlebnis. Die Christengemeinschaft hat in diesem Sinne auch niemals Kirchenbriefe und Denkschriften verteilt.“ (S. 166f)
„Das Krisenhafte hat dramatische Kontur, das Konstruktive stellt sich dagegen oft wie eine selbstverständliche und treue Fortführung dessen dar, worauf Gemeindemitglieder und Pfarrer schon vorher und weiterhin vertrauen können. Die sonntägliche Teilnahme der Gemeindemitglieder am Abendmahl, die Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche, die vielen seelsorgerlichen und festlichen Begegnungen in den Gemeinden sind in diesem Sinne keine aktuellen Nachrichten – aber ein andauerndes Glück.“ (S. 93)
Ein Buch, das mir am Herzen liegt
Da mir der Autor seit bald 25 Jahren aus der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen bekannt ist, insbesondere aus der Arbeit bei Kinder- und Jugendfreizeiten, und ich ihm viel verdanke, freut es mich auch persönlich, Ihnen dieses Buch empfehlen zu können. – Falls es Ihnen möglich ist, tun Sie gern etwas für die Verbreitung, und sei es, dass Sie Ihre Ortspfarrerinnen und Ortspfarrer gegebenenfalls auf die Idee bringen, es bei einer Gemeindeveranstaltung vorzustellen …

Verfasst Johannes Roth
Öffentlichkeitsbeauftragter der Christengemeinschaft, Pfarrer in der Gemeinde in Stuttgart-Mitte